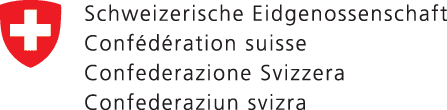ENSI-Direktor im Interview: „Fukushima darf bei uns nicht passieren“
Vor zwei Jahren ist es im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi zur Reaktorkatastrophe gekommen. Die Lehren daraus haben zur Verbesserung der Sicherheit der Schweizer Kernkraftwerke beigetragen, erklärt Hans Wanner, Direktor des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI, in einem Interview mit der Zeitung Die Botschaft.
Die Botschaft: Herr Wanner, wenn Sie zurückdenken an die Ereignisse vom März 2011 und daran denken, was sich seither schweizweit im Bereich der nuklearen Sicherheit getan hat und welche Hebel in der Energiepolitik in Bewegung gesetzt wurden, was geht Ihnen durch den Kopf?
Hans Wanner: Das Ereignis vom Fukushima hat bewirkt, dass die Weichen in der Energiepolitik der Schweiz innert kürzester Zeit neu gestellt wurden. Die Projekte für den Bau von Kernkraftwerken der neuesten Generation wurden sistiert, und wir mussten unsere Prioritäten umgehend neu ausrichten. Im Bereich der nuklearen Sicherheit haben wir weitere Verbesserungsmassnahmen angeordnet, können aber aufgrund der Ergebnisse des EU-Stresstests mit Überzeugung sagen, dass die Schweizer Kernkraftwerke im internationalen Vergleich einen hohen Sicherheitsstand haben.

Wie würden Sie im Rückblick die Arbeit am ENSI in den ersten Tagen nach dem Kernkraftwerkunfall beschreiben?
Hektisch und belastend. Meine Mitarbeitenden haben aber Enormes geleistet, um dem Informationsbedürfnis der Entscheidungsträger und der Öffentlichkeit nachzukommen und die ersten Massnahmen für die Schweiz einzuleiten.
Mehrmals täglich informierte das ENSI zur Situation vor Ort in Japan. Wie kamen Sie zu diesen Informationen und wann hatten Sie erstmals eigene Leute vor Ort?
Es war insbesondere in den ersten Tagen nach dem Erdbeben in Japan nicht einfach, an Informationen zu kommen. Als Aufsichtsbehörde ist man auf gesicherte Informationen angewiesen und kann sich nicht auf Gerüchte und Spekulationen abstützen. Unsere Fachleute hatten die Aufgabe, die Vielzahl von Informationen auf Plausibilität zu prüfen, damit wir uns ein möglichst realistisches Bild von den Abläufen in Fukushima machen konnten. Eigene Leute hatten wir in der ersten Zeit nicht in Fukushima. Wir haben aber die Schweizer Botschaft in Tokio mit Fachleuten aus dem Bereich Strahlenschutz unterstützt.
Gab es in jenen hektischen Tagen überhaupt Gelegenheit, durchzuatmen, etwas zurückzutreten und sich einen Überblick zu verschaffen?
Kaum. Das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Informationen und Einordung war unglaublich gross. Und daneben galt es ja auch noch die fachtechnische Arbeit zu leisten.
Hat sich das Arbeiten respektive die Arbeitskultur am ENSI seit März 2011 verändert?
Die markanteste Veränderung ist sicherlich die Sistierung der Neubauprojekte. Vor Fukushima richteten wir das ENSI auf den Neubau aus. Seit Fukushima setzen wir die Ressourcen, die durch die Sistierung freigeworden sind, für die Aufarbeitung von Fukushima ein. Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Hinzu kommt, dass mit dem Ausstiegsentscheid der Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke in den Fokus gerückt ist. Auch der Aspekt der Stilllegung von Kernkraftwerken hat an Bedeutung gewonnen. Fragen der Kultur wie Sicherheitskultur sind seit Tschernobyl ein Dauerthema, dessen Wichtigkeit durch Fukushima erneut bestätigt wurde. Und nicht zu vergessen: Seit zwei Jahren schenkt man uns in der Öffentlichkeit deutlich mehr Aufmerksamkeit.
Kurz nach den Ereignissen in Japan forderte das ENSI von den schweizerischen Kernkraftwerkbetreibern eine Vielzahl an Nachweisen. Nachweise, die sonst nicht verlangt worden wären. Sind die Schweizer Kernkraftwerke heute sicherer als vor zwei Jahren?
Sie hatten schon vor zwei Jahren einen hohen Sicherheitsstand, das haben die neu erbrachten Nachweise bestätigt. Auf Grund der Erkenntnisse aus Fukushima konnte die Sicherheit aber noch weiter verbessert werden. Das ist jedoch kein neuer Effekt. Wir nutzen jedes Ereignis, um daraus zu lernen und allfällige Verbesserungen daraus abzuleiten.
Ganz konkret gefragt: Was heisst für Sie Sicherheit?
Das Kernenergiegesetz schreibt vor, dass Mensch und Umwelt vor den Gefahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie zu schützen sind. Das Mass an „Sicherheit“, an dem wir uns in unserer Arbeit als Aufsichtsbehörde orientieren, wird ebenfalls vom Gesetz vorgegeben. Darüber hinaus müssen die Kernkraftwerke über zusätzliche Sicherheitsreserven verfügen.

Ihr Job als ENSI-Direktor wurde nach Fukushima sicher nicht weniger anspruchsvoll. Wie war es in den letzten zwei Jahren eines der umstrittensten Schweizer Institute – man denke an das „boykottierte“ ENSI-Forum und die Mahnwache – zu führen?
Ich empfinde meine Arbeit als eine spannende Herausforderung. Dazu gehört auch der Dialog mit den verschiedenen Interessensvertretern. Eine grosse Arbeitsbelastung hatten vor allem die Ingenieure und Techniker in den Fachsektionen. Neben der täglichen Aufsichtsarbeit und den grossen Projekten in den Kernkraftwerken galt und gilt es auch noch die Aufarbeitung von Fukushima zu bewältigen.
Haben Sie mit den Menschen der Mahnwache auch gesprochen? Was war der Inhalt solcher Gespräche?
Ich führe immer wieder Gespräche mit Vertretern der Mahnwache, sei es bei uns vor dem Eingang oder bei Treffen und Veranstaltungen bei uns im Haus. Dabei geht es um ihre Sorgen bezüglich der Sicherheit der Kernkraftwerke – insbesondere Beznau.
Gibt es Entscheide der letzten zwei Jahre, die Sie heute anders fällen würden?
Nein. Wir haben unsere Entscheide in der Retrospektive analysiert. Auch aus heutiger Sicht waren die Entscheide richtig. Aber es gab in den vergangenen zwei Jahren auch neue Erkenntnisse, die früheren Entscheidungen eine andere Bedeutung gaben. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass die Wasserstoffproblematik in den Brennelementlagern weniger akut ist als ursprünglich angenommen.
Das ENSI hat zu den Ereignissen in Japan mehrere Berichte verfasst, „Lessons Learned“ publiziert und einen Aktionsplan entworfen. Welches sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten, zentralen „Lessons Learned“?
Alle Lehren sind wichtig, aber nicht alle von gleicher zeitlicher Dringlichkeit. Im Vordergrund steht für mich die Erkenntnis, dass wir uns konkreter mit Fragen der Bewältigung eines grossen Unfalls beschäftigen müssen. Da müssen verschiedene Behörden grenzübergreifend einwandfrei zusammenarbeiten. Das wurde in der Schweiz bisher vielleicht etwas unterschätzt. Deshalb werden jetzt in einem gross angelegten Projekt unter der Federführung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz die gesetzlichen Grundlagen und organisatorischen Massnahmen neu überprüft.
Wo sehen Sie zwei Jahre nach dem Reaktorunfall in Japan bei den Schweizer Kernkraftwerken nach wie vor Handlungsbedarf?
Viele Projekte zur Verbesserung der Sicherheit wurden von den Betreibern bereits angepackt. Der Aktionsplan 2013 zeigt aber auch, dass es nach wie vor offene Fragen gibt. Dazu zählen etwa extreme Wetterbedingungen, das Notfallmanagement auf schweizerischer Ebene oder auch die Erhöhung der Sicherheitsmargen. Sicherheit ist ein Prozess und entsprechend werden die Arbeiten zur Verbesserung der Sicherheit nie abgeschlossen sein, solange Kraftwerke betrieben werden.

Sie waren mittlerweile auch in Japan, wenn ich mich nicht irre. Wie haben Sie die Reise erlebt? Welche Eindrücke mitgenommen?
Ja, ich hatte im Anschluss an eine internationale Konferenz in der Präfektur Fukushima kurz vor Weihnachten die Gelegenheit, Fukushima Daiichi zu besichtigen. Der Besuch war beeindruckend, einerseits wegen der immensen Schäden, andererseits auch wegen der Anstrengungen, die von den Japanern unternommen werden. Der Besuch hat mich aber auch darin bestärkt, dass wir mit unserer Arbeit, mit den Lehren die Kernkraftwerke sicherer zu machen, auf dem richtigen Weg sind. Fukushima darf bei uns nicht geschehen und ich bin auf Grund der bisherigen Sicherheitsüberprüfungen überzeugt, dass Fukushima bei uns nicht passieren kann.
Welche Ergebnisse und Erfahrungen haben Sie von diesem „Kernenergie-Gipfel“ in Japan mitgenommen?
Die internationale Gemeinschaft ist gewillt, die Nutzung der Kernenergie sicherer zu machen. Wir haben uns einmal mehr für eine Stärkung der internationalen Sicherheitsanforderungen eingesetzt. Unsere wichtigsten Anliegen wurden aufgenommen. Diese betreffen unter anderem die Verwendung von neusten Gefährdungsannahmen bei der Sicherheitsüberprüfung von Kernkraftwerken. Diese sollen dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Wir fordern auch regelmässige Überprüfungen aller Kernkraftwerke und Aufsichtsbehörden durch internationale Experten und die Offenlegung der Ergebnisse, so wie es in der Schweiz üblich ist.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie lesen, dass Greenpeace zwei Jahre nach Fukushima zum Schluss kommt, dass die Katastrophe in Japan Menschengemacht war?
Das ist keine neue Erkenntnis. Wir haben das bereits in unserer Analyse geschrieben, die wir im Sommer 2011 veröffentlicht haben. Es ist aber gefährlich, jetzt mit dem Finger auf Personen zu zeigen. Sicherheit braucht auch eine Kultur – eine Kultur, in der Fehler offen zugegeben und diskutiert werden und dadurch Verbesserungen vorgenommen werden. Wenn es nur noch um die Suche nach Schuldigen geht, zerstört man diese Sicherheitskultur und gefährdet damit auch die Sicherheit.
Greenpeace sagt auch, dass die Arbeitshypothese des ENSI-Direktors – „unsere Kernkraftwerke sind grundsätzlich sicher“ – falsch und verheerend sei und die Aufsicht der Schweizer Kernkraftwerke ungenügend sei. Was meinen Sie dazu?
Das Gesetz schreibt vor, dass ein Kernkraftwerk sicher sein muss, damit es betrieben werden darf. Wenn es nicht sicher ist, muss es ausser Betrieb genommen werden. Es ist unsere Aufgabe als Aufsichtsbehörde, die Sicherheit und den sicheren Betrieb durchzusetzen. Dazu führen wir Inspektionen durch, fordern Nachweise und prüfen Gesuche. Das machen wir mit wachsamen Augen und einer kritischen Haltung.
Die Neutralität des ENSI ist in der Öffentlichkeit immer wieder Thema. Was verstehen sie unter neutral?
Es geht um Unabhängigkeit. Wir sind wirtschaftlich und politisch unabhängig. Wir lassen uns in unserer Beurteilung nicht beeinflussen. Für uns hat die Sicherheit oberste Priorität.
Und wie stehen Sie als ehemaliger Gemeindeammann von Tegerfelden eigentlich zur Kernenergie?
Emotionslos. Mir geht es um den Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie.
Wenn Sie nicht gerade das ENSI führen, dann leben Sie im Surbtal. War es in den vergangenen zwei Jahren schwieriger als auch schon, zu Hause abzuschalten?
Selbstverständlich nimmt man gewisse Gedanken auch mit nach Hause. Ich darf mich aber glücklich schätzen, in einem Umfeld zu leben, das meinem Leben auch noch andere Inhalte gibt.
(Quelle: Die Botschaft, Ausgabe vom 11. März 2013)