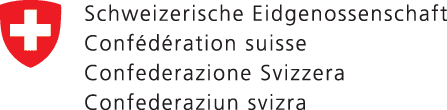Zehn Jahre nach Fukushima (6/6): Schlussfolgerungen
Vor genau zehn Jahren, am 11. März 2011, hat sich der katastrophale Unfall in Fukushima-Daiichi ereignet. In den letzten Wochen haben wir in unserer Artikel-Serie die Ursachen, den Ablauf und die Auswirkungen beleuchtet und die Erkenntnisse, die wir aus dem Unfall gezogen haben, beschrieben.
Die Ereignisse in Japan sind noch immer Mahnung, in der Wachsamkeit nicht nachzulassen. Es gilt, die Sicherheit der Schweizer KKW bis zum letzten Betriebstag zu gewährleisten. Denn Fukushima hat schmerzlich gezeigt, dass der Schlüssel für den Erhalt der Sicherheit das kontinuierliche und konsequente Nachrüsten nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik sowie die unabhängige Aufsicht sind.

Der folgenschwere Unfall in Fukushima hat uns wertvolle Erkenntnisse gebracht. So zeigten internationale Vergleiche und Überprüfungen der Technik und der Aufsicht, dass die Schweiz ihre Hausaufgaben gemacht hat: Die KKW erfüllen nicht nur alle Empfehlungen der internationalen Gremien, sondern stehen im internationalen Vergleich im Hinblick auf die Sicherheit sehr gut da. Das Schweizer Regelwerk zur nuklearen Sicherheit ist vorbildlich und die Schweizer Aufsicht ist unabhängig.
Auch wenn wir in der Schweiz hohe Sicherheitsstandards erfüllen, hat uns Fukushima-Daiichi eine Vielzahl wertvoller Hinweise gegeben, wie die Sicherheit der Schweizer Kernanlagen weiter verbessert werden kann. Diese Hinweise haben wir im Aktionsplan Fukushima festgehalten. Basierend darauf konnten wir weitere Nachrüstungen verfügen. Ausserdem veröffentlichten wir unsere Analyse des Unfalls in sechs Fukushima-Berichten. In zwei dieser Berichte analysierten wir die menschlichen und organisatorischen Faktoren des Unfalls, . ein dritter Bericht wird voraussichtlich bereits heute am 10. Jahrestag des Unfalls publiziert. Auch wurden zahlreiche Erkenntnisse als Vorgaben für die Sicherheit in die Gesetzgebung und in das Regelwerk des ENSI eingearbeitet und werden auch in Zukunft in diese einfliessen. Zudem lassen wir regelmässig unsere Aufsichtstätigkeit von internationalen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten überprüfen. So findet im Oktober dieses Jahres wiederum eine Mission der IAEA in der Schweiz statt. Die internationalen Expertinnen und Experten werden unsere Aufsichtstätigkeit und das schweizerische System in Bezug auf die Kernkraftwerkssicherheit überprüfen. Und wir setzen uns sowohl schweizweit als auch international für hohe Sicherheitsstandards und eine harmonisierte Aufsichtspraxis ein.
Der Unfall in Japan hat ausserdem einen weiteren wichtigen Aspekt in den Fokus gerückt: den Notfallschutz. Fukushima ist auch hier wertvolle Mahnung, sich nicht in Sicherheit zu wiegen. Trotz aller Sorgfalt – ein Restrisiko wird immer bleiben. Es ist also unsere Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass in der Schweiz und international die Folgen eines allfälligen Unfalls so weit wie möglich gemildert werden. So hat Fukushima die internationale Strahlen- und Notfallschutzgemeinschaft und alle Länder, die über Kernkraftwerke verfügen, mit der Frage konfrontiert, ob die Massnahmen, die wir zum Schutz der Bevölkerung planen, auch wirklich verhältnismässig sind. Dabei geht es insbesondere um die vorsorgliche Evakuierung der Bevölkerung, die auch in der Schweiz als wichtige Strategie zum Schutz vor einer allfälligen Strahlenbelastung nach einem Kernkraftwerksunfall vorgesehen ist. Fukushima hat das Folgende gezeigt: Entgegen der weitverbreiteten Meinung war die Strahlenbelastung insgesamt gesehen relativ moderat. Es gab keine Strahlentoten und eine mittel- und langfristige Zunahme der Krebserkrankungen ist gemäss mehreren internationalen Studien (UNSCEAR, WHO, IAEA) nicht zu erwarten. Die grossräumigen Evakuierungen hatten jedoch teils schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung. Es kam zu zahlreichen Todesfällen. Die Ursachen sind vielschichtig und reichen beispielsweise vom zeitweisen Unterbruch der medizinischen Versorgung aufgrund der Evakuierung der Spitäler und der Alters- und Pflegeheime bis hin zu psychischen Erkrankungen und deren Folgeerscheinungen.
Diese Erkenntnis rückt die sogenannte «Sheltering-Strategie» wieder vermehrt in den Fokus der Überlegungen. Denn Evakuierungen sind nicht die einzig denkbare Massnahme, die bei einem Nuklearunfall zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden kann. Im Falle einer Strahlenbelastung könnte die auch im internationalen Vergleich hervorragende Bausubstanz unserer Wohnhäuser bereits einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor ionisierender Strahlung leisten. Auch hat die Coronasituation gezeigt, dass «Sheltering» – also das Zuhausebleiben und der reduzierte Aufenthalt im Freien – für eine gewisse Zeit recht gut funktionieren kann. Das ENSI sucht daher national und international die Diskussion mit Notfallschutzpartnern, um die Vor- und Nachteile verschiedener Schutzmassnahmen abzuwägen und zu überlegen, wann und wie diese auch kombiniert zur Anwendung kommen können.
Ein zentraler Punkt dabei ist und bleibt der Umgang mit der in vielen Menschen tief verwurzelten Verunsicherung und Angst vor radioaktiver Strahlung. Diese diffuse Angst muss ernstgenommen werden. So betrachtet es das ENSI auch als seine Aufgabe, in Zukunft vermehrt sowohl Verantwortungsträgerinnen und -träger und Notfallorganisationen als auch die Bevölkerung über radioaktive Strahlung und deren Auswirkungen im Zusammenhang mit Kernkraftwerksunfällen zu informieren. Hierbei geht es nicht darum, den katastrophalen Unfall in Fukushima zu verharmlosen und die Gefahr, die von ionisierender Strahlung ausgeht, kleinzureden. Vielmehr geht es darum, die Gefahren der Strahlung ins richtige Verhältnis zu rücken.
Zusammenfassend gilt für die Schweiz, sich nicht zurückzulehnen, sondern stets aufmerksam und kritisch zu bleiben, die Technik und Aufsichtstätigkeit regelmässig zu überprüfen und die Nuklearanlagen bis zur Ausserbetriebnahme auf dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik nachzurüsten. «Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein», sagte einst der deutsche Politiker Philip Rosenthal. Das gilt genauso für die Betreiber von Kernanlagen wie auch für das ENSI! Und nicht zuletzt geht es darum, dass das ENSI auch in Zukunft unabhängig von politischem oder wirtschaftlichem Druck seine Entscheidungen treffen und den für seine Expertise notwendigen Kompetenzerhalt sicherstellen kann.
Marc Kenzelmann, Direktor